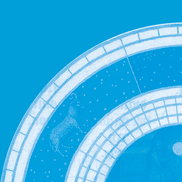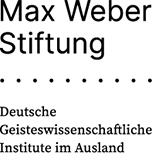Die Antwort auf diese Frage scheint einfach: Museen gehören ihren Trägern, dem Staat, lokalen Behörden, privaten Eigentümern. Aber was bedeutet dies in der Praxis? Wie kann man die wissenschaftliche und professionelle Unabhängigkeit von Museen gegenüber ihren Geldgebern gewährleisten? Wie kann anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, vor allem aber denjenigen Gruppen, deren Geschichte und Kultur die Museen gewidmet sind, ein Mitspracherecht an ihrer Gestaltung gegeben werden?
Diese Fragen wurden während des 20. Joachim-Lelewel-Gesprächs mit ausgewiesenen ExpertInnen und MuseumspraktikerInnen aus Belgien, Deutschland, Polen und den USA diskutiert. Piotr Majewski, ehemaliger stellvertretender Direktor des Museums des Zweiten Weltkrieges in Danzig, schilderte, wie sich die Situation in den letzten Jahren in Polen entwickelte. Die Frage nach der wissenschaftlichen Autonomie von Museen wurde akut, nachdem die damals neu gewählte nationalkonservative PiS-Regierung eine „feindliche Übernahme“ des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig (2017) durchführte. Dem folgten personelle Eingriffe in weiteren Einrichtungen, wie z. B. im Warschauer Nationalmuseum oder dem Museum der Geschichte der Polnischen Juden POLIN. Auch andere Museen seien im Zuge dessen unter politischen Druck geraten.
Es stelle sich also die Frage, ob die Situation in Polen gänzlich neu sei. Oder ist sie womöglich das Ergebnis einer lang anhaltenden Malaise der polnischen Kulturpolitik? Einer Kulturpolitik, die es in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, ein rechtliches System zu schaffen, das den öffentlichen Museen eine größere Unabhängigkeit von der Tagespolitik sichern würde? Laut Majewski habe es nach der Wende tatsächlich keine größeren öffentlichen Debatten zur Sicherung der Autonomie von Museen gegeben. Immerhin seien aber an den meisten öffentlichen Museen Aufsichtsräte und wissenschaftliche Beiräte etabliert und so eine Struktur geschaffen worden, die noch bis vor kurzem gut funktionierte. Doch in der letzten Zeit – insbesondere nach 2015 – würden einige Schwächen des Systems erkennbar, so Majewski. Als Beispiel führte er die Regelung an, dass der Kultusminister „unbequeme“ Museumsdirektoren, wie im Fall des POLIN, nicht berufen müsse – und dies sogar gegen die Entscheidung der Wettbewerbs-Jury. Aus seiner Erfahrung als langjähriger Direktor der Gedenkstätte Sachenhausen und Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten berichtete Günther Morsch anschließend von dem Kompromiss, der in Deutschland nach langem Ringen erreicht worden sei: Nach der Wende sei es darum gegangen, zwei unterschiedliche Erinnerungskulturen, die ost- und die westdeutsche, zusammenzubringen.
Das Ergebnis war einerseits der Versuch, die kleinen, dezentralen und auf Bürgerinitiativen basierenden Institutionen zu erhalten, die in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik entstanden waren. Andererseits fanden sich einige der kleineren Gedenkstätten zu größeren staatlich finanzierten Einrichtungen zusammen. So entstanden selbständige Stiftungen des öffentlichen Rechts, die unmittelbar dem Parlament unterstellt sind. Ihre Struktur aus Stiftungsdirektion, Fachkommission, einem international besetzten Gesellschaftsbeirat und einem Stiftungsrat, in dem sowohl die Bundesregierung, wie auch die jeweilige Landesregierung vertreten sind, soll eine hohe Autonomie sicherstellen und die Institution vor politischer Vereinnahmung schützen. Natürlich gebe es auch in Deutschland beunruhigende Entwicklungen. Durch die immer kleiner werdende Zeugengeneration verlieren die NS-Gedenkstätten an gesellschaftlicher Verankerung. Zweitens würden Leiterinnen und Leiter von Museen und Gedenkstätten zunehmend befristet eingestellt und büßten dadurch ihre Unabhängigkeit ein. Drittens schwinde das internationale Interesse an deutschen NS-Gedenkstätten, was die internationale Kontrolle zunehmend schwieriger mache.
Ein weiterer Akteur, den es zu berücksichtigen gelte, seien die Erfahrungs- bzw. Erinnerungsgemeinschaften, deren Geschichte in den Museen thematisiert wird. Am Königlichen Museum für Zentralafrika in Tervuren wurde, wie die Kunsthistorikerin und gesellschaftliche Aktivistin Anne Wetsi Mpoma berichtete, ein Komitee berufen, dass sich aus Vertretern der afrikanischen Diaspora in Belgien zusammensetzte. Dieses lud eine Expertengruppe – darunter auch Mpoma selbst – dazu ein, das Museum bei seiner Umgestaltung zu beraten. Zu ihrem Bedauern war diese Zusammenarbeit nicht institutionalisiert und hätte jederzeit von Seiten der Museumsmitarbeiter abgebrochen werden können. Aus Sicht der Aktivistin wäre es wichtig gewesen, einen offiziellen Rahmen für diese Konsultationen zu schaffen und alle Interessierten ins Gespräch einzubeziehen, anstatt nur mit denjenigen zu sprechen, deren Vorstellungen denen der Museumsträger und -Kuratoren entsprechen. Anders gestaltete sich die Entstehungsgeschichte des National Museum of African American History and Culture in Washington DC. Davon berichtete Dwandalyn Reece, die dort als stellvertretende Direktorin und leitende Kuratorin tätig ist. Das NMAAHC erwuchs aus der Tradition der gemeindebasierten Museen (community based museums), wie sie in den USA bereits seit den 1960er Jahren entstehen. Ziel war es, die Geschichte der ethnischen oder kulturellen Gruppen zu erzählen, die in den großen staatlichen Einrichtungen marginalisiert wurden. Für Reece ist die Grenze zwischen den Akademikern und den sog. source communities verschwommen, denn die Expertise sei an verschiedensten Orten zu finden. Daher sei es von Beginn an das Anliegen des NMAAHC gewesen, nicht nur die afroamerikanische Geschichte zu präsentieren, sondern auch die Communities dazu zu ermächtigen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Obwohl dies aus Sicht der Expertin als gelungenes Joint Venture gelte, komme es natürlich auch hier immer wieder zu Spannungen, z. B. bezüglich des Umgangs mit Objekten. Die Autorität über das Museum mit den Communities zu teilen sei folglich eine wahre Herausforderung, weshalb die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit auchin Zukunft weiter exploriert werden müssten.
Gegenstand der Diskussion war auch, wie potentielle Konflikte zwischen den verschiedenen Communities ausgehandelt werden können und welche Rolle den Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zukomme. Hier unterschieden sich die Meinungen von Günter Morsch und Dwandalyn Reece leicht. Reece sah die Museumsexperten weniger als letzte Entscheidungsinstanz und mehr als Vermittler zwischen den verschiedenen Gruppen. Auch wurde auf die Frage aus dem Publikum nach der wissenschaftlichen Autonomie der Museen in Belgien und den USA eingegangen und diskutiert, inwieweit diese politischem Druck ausgesetzt sind. Piotr Majewski beantwortete außerdem eine Frage nach der Haltung des polnischen Historikermilieus zu den Geschehnissen am Danziger Museum des Zweiten Weltkrieges. Abschließend wurden alle Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer gebeten, in jeweils fünf Sätzen ihre Antwort auf die Eingangsfrage zu formulieren: Wem gehört das Museum?
Das 20. Joachim-Lelewel-Gespräch „To whom does the museum belong?“ fand am 8. Juli im Rahmen der Fünften Jahreskonferenz der Memory Studies Association „Convergences“ (5.–9. Juli 2021) statt. Die englischsprachige Online-Debatte wurde aufgezeichnet und ist unter https://www.youtube.com/watch?v=vCeqU9NVghU&t=3314s abrufbar.